Die Gaststätte Fischhaus
gehört zwar nicht mehr zu Almrich , aber vielen Almrichern ist die Gaststätte
gut bekannt und wird immer wieder als beliebtes
Ausflugsziel oder für Feierlichkeiten in Anspruch genommen.
Seit 2006 die neuen Wirtsleute das Fischhaus übernommen
haben ist die Resonanz um so größer geworden.
.

NTB 25.06.2008
Das Fischhaus – ein Idyll am
Saaleufer
Klaus-Dieter Fichtner
Seit langer Zeit ist das Fischhaus – unmittelbar über dem Saaleufer zwischen der
Landesschule Pforta und dem Allerheiligenberg gelegen – ein gern aufgesuchter
Rastort. Man blickt hinunter auf den ruhig dahin strömenden Fluss, der sich hier
verengt und den auf beiden Ufern alter Baumbestand und Gebüsch säumen. Die
kleine Häusergruppe ist mit der Geschichte des Zisterzienserklosters St. Marien
zur Pforte und ihrer Nachfolgerin, der Landesschule, untrennbar verknüpft. Der
Ursprung der Besiedlung dieses Ortes ist lange vor dem Bau des Saaledammes zu
suchen, durch den die Grauen Mönche die Saaleauen vor den Unbilden der
Hochwasser schützen (1302).
Von Historikern ist die Vermutung ausgesprochen worden, dass an dieser Stelle
bereits Sorben ein festen Bau errichteten – befanden sich doch jenseits der
Saale die sorbischen Siedlungen Tauschwitz und Thesnitz, die später zu Wüstungen
verkamen. Zum Lebensunterhalt ihrer Bewohner gehörte sicher auch der Fischfang.
Belege können dafür jedoch nicht erbracht werden (vgl. Pahnke 1956, 48).
Boehme geht davon aus , dass das Fischhaus 1306 erstmalig erwähnt wird (Boehme
1893, 228 und 390), doch kann heute ein noch früheres Datum belegt werden. Eine
Urkunde des Naumburger Domes vom 24.April 1270 – unterzeichnet von Probst
Meinher und Dechant Dietrich – enthält den Passus:“[…] directe contra domum, que
domus piscariae nominatur […]“ (gerade gegenüber dem Haus, welches Fischhaus
genannt wird). (Pahnke 1954, 185).
Der Fischfang, zu dem das Kloster die Gerechtsame vom Kösener Wehr bis nach
Roßbach besaß, war ein wichtiger Teil der Wirtschaft der Mönche, ebenso wie auch
schon früh ein Fährbetrieb vermutet werden darf. Der Fischreichtum der Saale
wurde besonders in der Fastenzeit benötigt und diente später als willkommene
Einnahmequelle für den Handel des Marienklosters. Zunehmender Raubfang in den
sächsischen Landen veranlasste 1556 Kurfürst Moritz, eine Fischereiordnung zu
erlassen, die der Naumburger Bischof Pflug 1561 nochmals bekräftigte (Hoppe
1930, 49). Damit musste auch die Landesschule in Pforte diese Weisungen
beachten. So durfte im Frühling bis zum Tag Johannes des Täufers (24. Juni) nur
wochentags von Sonnenaufgang bis 11:00 Uhr gefischt werden; für die gefangenen
Fische war ein Mindestmaß festgelegt, die Geräte mussten bestimmten Vorschriften
entsprechen und wurden daraufhin überprüft. Die Saale und ihre Ufer durften
nicht verunreinigt werden. Selbst die Preise wurde reguliert: So kosteten im 17.
Jahrhundert ein Pfund Aal 3, ein Pfund Barsch oder Hecht 2 ½ Silbergroschen
(Hoppe 1930, 49).
In jenen Jahren wurden in der Saale 35 Arten von Fischen gefangen, darunter
Aale, Barsche, Hechte und Lachse. Von besonderer Bedeutung war der Lachsfang,
der jedoch nur unregelmäßige Erträge brachte. Ende des 16. Jahrhunderts
berichteten Chronisten, dass in manchem Jahr kein Lachs gefangen werden konnte.
Der Fischer im Fischhaus, dem allein das Recht zum Fang zustand, hatte jeden
gefangenen Lachs der Verwaltung der Landesschule zu übergeben, die ihn dann
verkaufte. Um den Lachszug flussaufwärts nicht zu behindern, war in das Kösener
Wehr schon in alten Zeiten auf der Mühlenseite eine sog. Lachstreppe eingebaut
worden, die bei allen nachfolgenden Veränderungen bis in die heutige Zeit stets
erhalten blieb.
Während große Lachse das Wehr übersprangen, benutzten die kleineren die
Lachstreppe. Eine Vorstellung von der Größe gefangener Lachse vermittelt die
Angabe, dass die Fische durchschnittlich 22 bis 23 Pfund wogen. 1579 wird von
zwei Lachsen berichtet, die zusammen 52 Pfund auf die Waage brachten. Zu Anfang
des 19. Jh. nahm der Ertrag des Lachsfangs zu, es wurden etwa 300 Stück jährlich
notiert.
Mit Beginn des 19. Jh. rückte das Fischhaus auch in den Blickpunkt des
Unterrichtsgeschehens der Landesschule. Der von F.L. Jahn 1811 in Berlin
geforderte Turnunterricht stieß an der Pforte auf Interesse. Nach einigen
Irritationen wurde zwischen 1825 und 1832 Turnen als verbindliches Fach
eingeführt und in der Folge kam es 1834 auch zur Einrichtung einer
Flußbadeanstalt am Fischhaus. Nichtschwimmer bewegten sich in einem um zäumten,
gesicherten Badebereich – von ihnen respektlos „Stall“ genannt. Das Schwimmen in
der freien Saale wurde erst nach dem Ablegen einer Probe gestattet, die darin
bestand, dass der Schüler dreimal, ohne auszuruhen, die Saale durchquerte. Das
Bestehen dieser „Prüfung“ berechtigte zum Tragen einer roten Kappe und eines
Ehrenzeichens. Zu den Aufgaben des später (1854) geschaffenen Anmannstandes
(Vorturner) gehörte auch der Schwimmunterricht.
Aus dem Schwimmen am Fischhaus entwickelte sich das jährliche Turn – und
Schwimmfest der Landesschule mit Wanderungen in die weitere Umgebung. Um diese
Entwicklung haben sich besonders Dr. Euler und die Professoren Kern und Sagorsky
verdient gemacht.
(Göldner 1924,1).
Eine Gaststätte entstand im Fischhaus erst relativ spät. In den frühen Zeiten
der Landesschule besaß der Fischer keine Schankgerechtigkeit, dennoch wurde der
Verkauf von Getränken als Nebengewerbe betrieben. 1825 erfolgte durch den Rektor
ein offizielles Verbot, das jedoch ein Jahr später wieder aufgehoben wurde.
Somit kann man das Jahr 1826 als den Beginn der Gastwirtschaft bezeichnen, die
mit dem Fährbetrieb verbunden war.
Die Versorgung der Gäste erfolgte allerdings im Sommerhalbjahr. Offensichtlich
nahm der Zustrom von Besuchern aus der Landesschule und den umliegenden Orten
zu, so dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Fischhaus als Ausflugsziel
bekannt wurde. 1853 ließ der Rektor der Landesschule, Kirchner, zwei
Schrifttafeln mit lateinischen Texten anbringen, die sich auch heute noch dort
befinden und die auf die beiden Gewerbe Bezug nehmen. Die Holztafel über der
Haustür trägt den von Kirchner selbst verfassten Spruch:
Hic lare sub parvo tiliae piscator in umbra cymba aut quemque vehit
piscibus reficit.
(Hier im Hause, dem kleinen im Schatten der Linde, der Fischer, jeden
setzt er über im
Kahn oder labt ihn mit Fisch).
An der Giebelwand des Hauses ist auf einer größeren Holztafel ein Zitat aus
den Oden des römischen Dichters Horaz (65 v. bis 8 n. Chr.) zu lesen:
Plerumque gratae divitibus vices mundaeque parvo sub lare pauperum cenae
sine aulaeis et ostro sollicitam explicuere frontem.
(Die von den Reichen gewünschte Abwechslung und die frischen Speisen
unter
dem Dach der Armen, ohne Teppich und Purpurdecke, haben schon oft die
besorgte Stirn geglättet; freie Übers.)
Abgesehen von diesem dichterischen Bekenntnis zur bescheidenen
Gaststätte, hat sich das Fischhaus zu einem Treffpunkt der Schüler und vieler
ehemaliger Pförtner entwickelt, den Wanderer zog seine Gastlichkeit an, der
Spaziergänger konnte hier über die Saale setzen. Sein dörflicher Charakter mit
Backhaus, Stallung und Garten, mit Fischreusen sowie mit Fischgerichten und
selbstgebackenen Kuchen gab ihm seinen besonderen Reiz.
Nach 1945 kam das Fischhaus unter kommunale Verwaltung der Stadt Bad Kösen. 1976
wurde die Sanierung vorgenommen uns stilwidrig ein Sanitärtrakt angebaut, der
nun das alte Ensemble stört. Jahrzehntelang wurde die Gastwirtschaft von der
Familie Mende betrieben, die zugleich auch die Fischerei aufrecht erhielt. Ihr
folgte die Familie Böhmer. Bedauerlicherweise wurde in den letzten Jahren der
Fährbetrieb eingestellt. Nachdem verschiedene Neuanfänge im Ansatz
steckengeblieben sind, wird nun mit Unterstützung des ehemaligen Pforten –
Schülers Dr. Heimbürge 1997 ein Fußgängerübergang flussabwärts der Gaststätte
errichtet, an dessen Bau sich die Städte Bad Kösen und Naumburg beteiligen
wollen.
Die idyllische Lage des Fischhauses hat, trotz der in der Nähe durchbrausenden
Eisenbahnzüge und der nahen B 87, immer wieder Künstler angeregt, das Fischhaus
„festzuhalten“. Das 1925 von Max Lingner gestaltete Aquarell „Im Garten des
Fischhauses“ – das 1987 in der Kunsthalle in Bad Kösen gezeigt wurde – soll als
Beispiel dafür dienen.
Möge das Anwesen in den kommenden Jahren seinen alten Ruhm und seine
Gastlichkeit wieder erhalten.
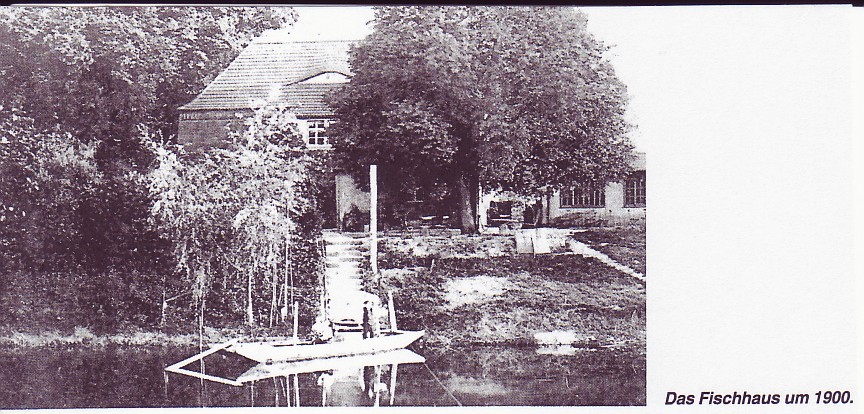
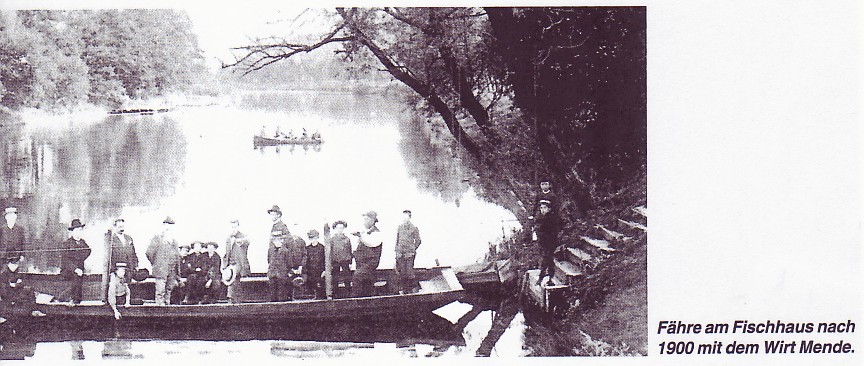


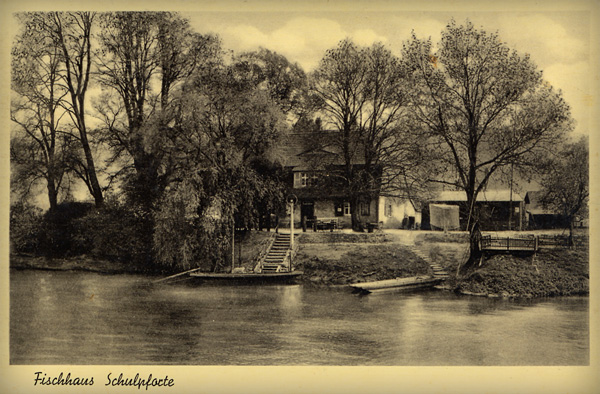

30.08.2008



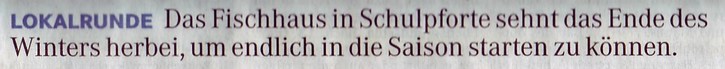
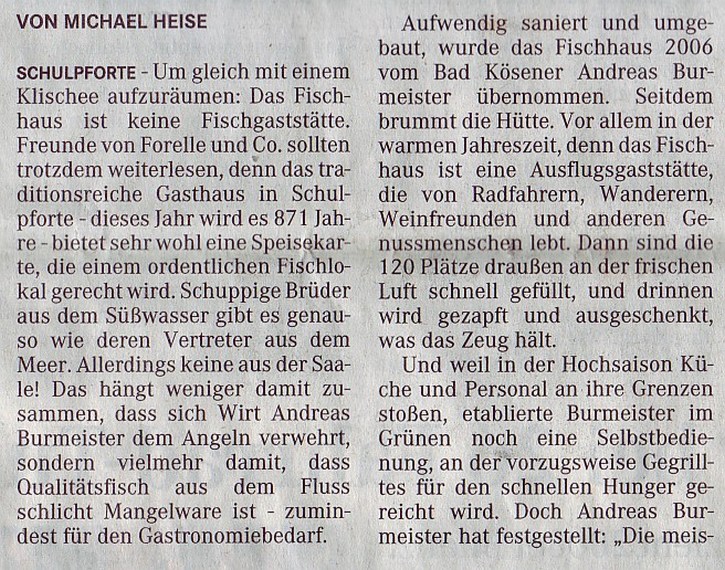
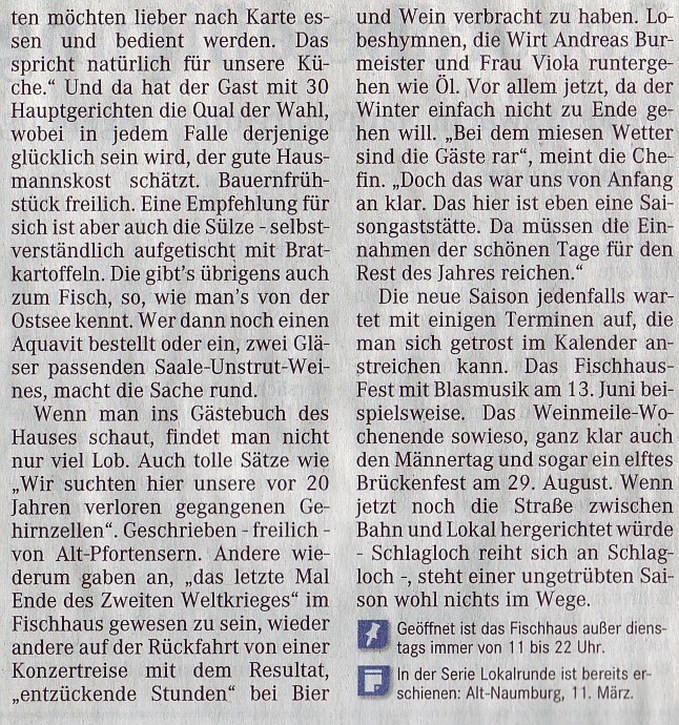
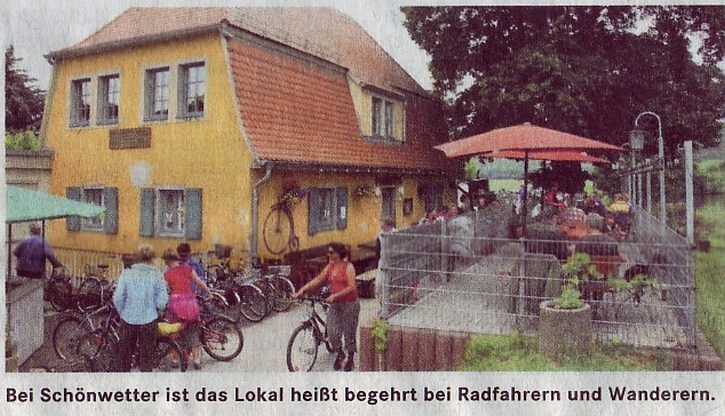
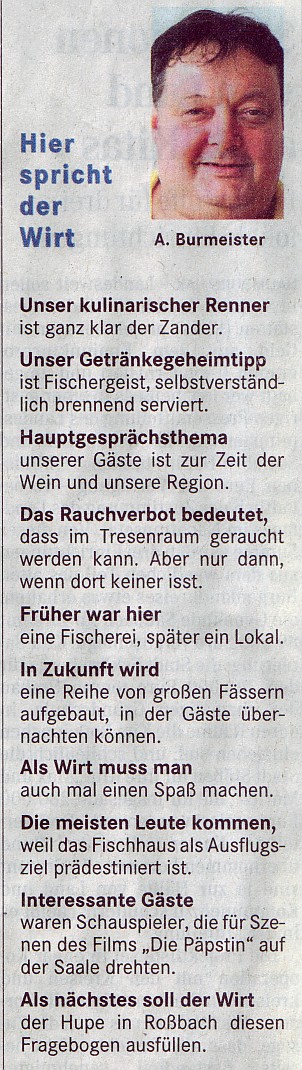

NTB 30.08.2011

NTB 06.05.2016

NTB 25.03.2023